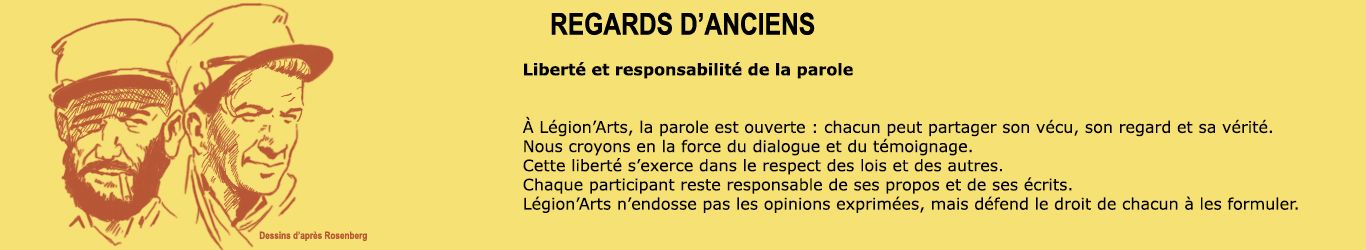Grünes Barett der Legion.
Dieser Text soll in erster Linie keine Kontroversen schüren oder institutionelle Entscheidungen bezüglich der Symbole der Fremdenlegion in Frage stellen. Er soll vielmehr eine historische und erinnerungswürdige Reflexion über ein Emblem sein, das im Laufe der Jahrzehnte eine symbolische Bedeutung erlangt hat, die weit über seine einfache Uniform hinausgeht.
Das grüne Barett ist ein kraftvolles Zeichen von Identität, Tradition und Opferbereitschaft. Seine Geschichte zu beschwören, bedeutet, an die Reise von Generationen französischer und ausländischer Legionäre zu erinnern, die zu seiner Legende beigetragen haben. Es geht daher nicht darum, den zeitgenössischen Gebrauch zu beurteilen, sondern vielmehr an die tiefe Bedeutung und die Ursprünge dieses Symbols zu erinnern, das durch Not und Kampf geprägt wurde.
Möge der Leser diese Zeilen mit Respekt für diejenigen lesen, die dieses Barett auf dem Schlachtfeld trugen, aber auch mit Verständnis für die natürliche Entwicklung einer lebendigen Institution, die aus Männern, Frauen und Erinnerungen besteht.
Hier ist seine Geschichte zwischen Legende, Ehre und Kontroverse.
Louis Perez y Cid
Louis Perez y Cid
Grünes Barett der Legion:
Ein Abzeichen, geboren im Blut, erkämpft in Ehre
Von Oberstleutnant (TE.ER) Antoine Marquet
Schwarz, Blau, Amarant, Grün … In der Vielfalt der französischen Militärbarette erzählt jede Farbe eine Geschichte, eine Waffe, eine Tradition. Doch nur eine kristallisiert einen Mythos und Kontroversen, die ihre tiefste Bedeutung berühren: das Grüne Barett der Fremdenlegion.
Ein Emblem, geschmiedet in Not
Die epische Reise des Grünen Baretts war nicht ohne Herausforderungen. Bereits 1949 forderten die Fallschirmjäger-Legionäre in Indochina das Amarant-Barett, das Abzeichen der französischen Fallschirmjäger. Das Oberkommando lehnte dies mit einem kategorischen Veto ab. Während dieses Konflikts, „im Schweiß und Blut“ der Kämpfe, entstand das Grüne Barett, beinahe geschmuggelt. Das 1. BEP war dagegen. Seine Einführung glich einer Zangengeburt.
Schwarz, Blau, Amarant, Grün … In der Vielfalt der französischen Militärbarette erzählt jede Farbe eine Geschichte, eine Waffe, eine Tradition. Doch nur eine kristallisiert einen Mythos und Kontroversen, die ihre tiefste Bedeutung berühren: das Grüne Barett der Fremdenlegion.
Ein Emblem, geschmiedet in Not
Die epische Reise des Grünen Baretts war nicht ohne Herausforderungen. Bereits 1949 forderten die Fallschirmjäger-Legionäre in Indochina das Amarant-Barett, das Abzeichen der französischen Fallschirmjäger. Das Oberkommando lehnte dies mit einem kategorischen Veto ab. Während dieses Konflikts, „im Schweiß und Blut“ der Kämpfe, entstand das Grüne Barett, beinahe geschmuggelt. Das 1. BEP war dagegen. Seine Einführung glich einer Zangengeburt.

Erst 1957 verbreitete es sich in der gesamten Legion. Die Fallschirmjäger zeichneten sich durch das berühmte Abzeichen des „geflügelten Rechtshänders“ anstelle der Siebenflammengranate aus. Als Symbol der Elite wurde es nur selten verliehen: an junge Rekruten ohne Abzeichen, bevor das weiße Käppi verliehen wurde, oder an bestimmte Spezialisten anderer Truppenteile bei bestimmten Missionen.

In Indochina hatten die Hilfstruppen, die an der Seite der Legion kämpften, nur Anspruch auf ein weißes Barett. Das grüne war das Vorrecht des Legionärs.

Die zeitgenössische Kontroverse: Wem steht das heilige Barett zu?
Diese Geschichte der Opfer verleiht dem grünen Barett eine fast heilige Aura. Daher wird sein Anblick auf manchen Köpfen heute von ehemaligen Legionären und vielleicht sogar von aktiven Legionären als Beleidigung empfunden.
Was sehen wir? Reservisten, die nie in einem Legionsregiment gedient haben, tragen es heute. Noch symbolträchtiger: Auch eine Frau, Archivarin oder Kuratorin im Legionsmuseum in Aubagne, trägt es. Obwohl sie Kadettin und Absolventin der Armee ist, hat sie nie ein Rekrutierungsbüro betreten oder das Leben auf einem „Bauernhof“ in Castelnaudary erlebt, wo die Seele eines Legionärs zum Teil geformt wird. Die Frage stellt sich daher mit aller Schärfe: Ist dieses im Schlamm des Schlachtfelds verdiente Barett zu einem bloßen Uniformaccessoire geworden oder bleibt es das ultimative Zeichen einer einzigartigen Zugehörigkeit, gefestigt durch unerschütterliches Engagement und spezifisches Training?
Warum sollte die Frau, die die Erinnerung an die Legion verkörpert, nicht die Attribute ihrer ursprünglichen Waffe tragen, anstatt das heiligste Abzeichen einer Familie, in die sie weder aufgenommen noch ausgebildet wurde?
PS: Die weiblichen Angehörigen der SEPP (Fallschirmwartungs- und -faltabteilung), die der 2. REP in Calvi zugeteilt sind, stammen aus Fallschirmjägereinheiten, die nicht der Legion angehören. In Uniform tragen sie das rote Barett.
Was sehen wir? Reservisten, die nie in einem Legionsregiment gedient haben, tragen es heute. Noch symbolträchtiger: Auch eine Frau, Archivarin oder Kuratorin im Legionsmuseum in Aubagne, trägt es. Obwohl sie Kadettin und Absolventin der Armee ist, hat sie nie ein Rekrutierungsbüro betreten oder das Leben auf einem „Bauernhof“ in Castelnaudary erlebt, wo die Seele eines Legionärs zum Teil geformt wird. Die Frage stellt sich daher mit aller Schärfe: Ist dieses im Schlamm des Schlachtfelds verdiente Barett zu einem bloßen Uniformaccessoire geworden oder bleibt es das ultimative Zeichen einer einzigartigen Zugehörigkeit, gefestigt durch unerschütterliches Engagement und spezifisches Training?
Warum sollte die Frau, die die Erinnerung an die Legion verkörpert, nicht die Attribute ihrer ursprünglichen Waffe tragen, anstatt das heiligste Abzeichen einer Familie, in die sie weder aufgenommen noch ausgebildet wurde?
PS: Die weiblichen Angehörigen der SEPP (Fallschirmwartungs- und -faltabteilung), die der 2. REP in Calvi zugeteilt sind, stammen aus Fallschirmjägereinheiten, die nicht der Legion angehören. In Uniform tragen sie das rote Barett.

Veröffentlichen Sie Ihren Text
Ehemalige der Legion: Über die Legion und andere Themen
Unterstützer: Über die Legion
Vorname
Familienname
Veröffentlichen Sie hier Ihren Text
Ihre Geschichte zum Upload, max. 5 MB
0 datei(en)