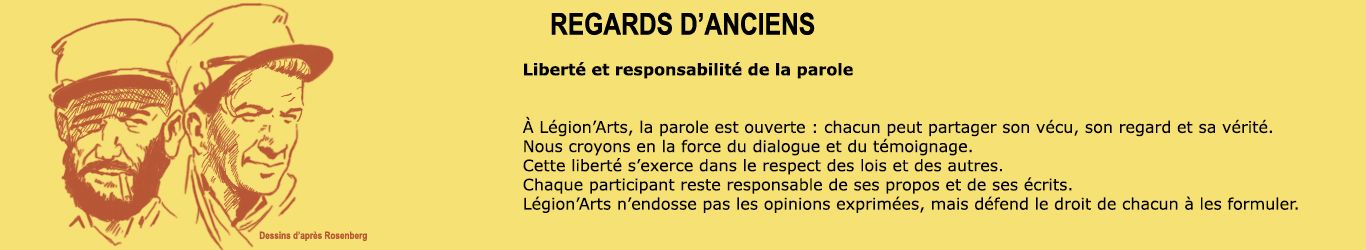Pflicht zur Erinnerung oder Gedenken?
Auch in diesem Jahr beteiligte sich unser Verein an der 83. Jahrestagung der Deportationen vom Lager Milles nach Auschwitz, die als „Pflicht zur Erinnerung“ präsentiert wurde.
Doch was bedeutet dieser Ausdruck, der oft bei Feierlichkeiten am 14. Juli, 11. November oder in Camerone zu hören ist, wirklich?
Ist es richtig, von einer „Pflicht zur Erinnerung“ zu sprechen?
Gedenken
Ein Gedenken besteht darin, die Erinnerung an ein Ereignis durch ein Datum, ein Denkmal, einen Straßennamen oder eine Zeremonie wachzuhalten.
Es würdigt eine bedeutende Episode der nationalen oder internationalen Geschichte und zielt darauf ab, die Gemeinschaft um eine gemeinsame Erinnerung zu vereinen.
Gedenken erinnern, feiern und vermitteln.
Pflicht zur Erinnerung
Die Pflicht zur Erinnerung hat einen anderen Zweck.
Sie zielt darauf ab, kollektives Vergessen zu verhindern und die Wiederholung der ideologischen Exzesse zu vermeiden, die zur Verfolgung führten. Es geht nicht nur darum, Tribut zu zollen, sondern eine moralische Lehre aus der Geschichte zu ziehen.
Der Ausdruck tauchte in den 1990er Jahren, lange nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust, auf und wurde später auf andere Tragödien wie die Sklaverei oder den Völkermord an den Armeniern ausgeweitet.
Er spiegelt eine moralische Verpflichtung wider: der Opfer zu gedenken, damit sich solche Tragödien nie wiederholen.
Für Staaten ist diese Pflicht unerlässlich, insbesondere wenn sie eine Verantwortung tragen.
Sie steht im Gegensatz zur alten Tradition der Amnestieverträge, die im Namen des Friedens das Vergessen erzwangen.
Die Pflicht zur Erinnerung hingegen erinnert uns daran, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit unverjährbar sind, d. h., sie können auch Jahrzehnte später noch strafrechtlich verfolgt werden.
Während der Camerone-Zeremonie:
Ist es eine Pflicht zur Erinnerung oder einfach nur ein Gedenken?
Louis Pérez y Cid
Veröffentlichen Sie Ihren Text
Ehemalige der Legion: Über die Legion und andere Themen
Unterstützer: Über die Legion
Vorname
Familienname
Veröffentlichen Sie hier Ihren Text
Ihre Geschichte zum Upload, max. 5 MB
0 datei(en)