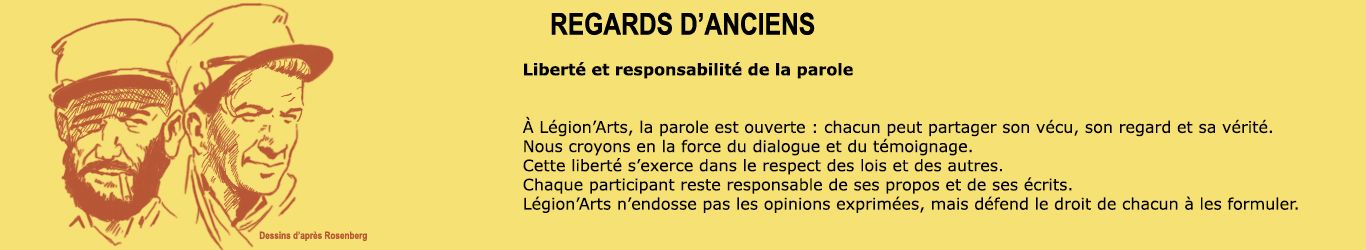Verflucht sei der Krieg...
Der Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs rückt näher. Der 11. November 1918. An diesem Tag wurde um 5:15 Uhr morgens der Waffenstillstand unterzeichnet, der den Sieg der Alliierten und die totale Niederlage Deutschlands markierte.
Tatsächlich trat der Waffenstillstand um 11:00 Uhr in Kraft und löste in ganz Frankreich Glockengeläut aus, das der Bevölkerung das Ende des Krieges verkündete, der mehr als 8 Millionen Tote, Behinderte und Verstümmelte forderte.

Im Rahmen der Gedenkfeiern zum hundertsten Jahrestag des Krieges von 1914–1918 bis 2018 ist ein Rückblick auf das Jahr 1922 interessant.
Warum 1922? Weil in diesem Jahr, vier Jahre nach dem Waffenstillstand, der Vorschlag, das Datum des Endes der Feindseligkeiten zu feiern, den Franzosen die Gelegenheit bot, die Verantwortung des imperialistischen Deutschlands für den Ausbruch dieses Krieges anzuprangern. Für viele Veteranen wäre es jedoch vergeblich, Lob für die Armee oder eine Verherrlichung der französischen Stärke zu suchen. Der Appell an den Völkerbund wurde begrüßt, ebenso wie die Betonung von Trauer und Opfern, die eine größere Bedeutung erlangen und als Lehre dienen müssen.
Die Weigerung, den 11. November zum Anlass einer Militärdemonstration zu nehmen, wurde in verschiedenen Reden, insbesondere auf dem Kongress der Französischen Union, mit folgenden Worten deutlich gemacht:
„Die Feierlichkeiten zum 11. November werden keine Militärdemonstrationen beinhalten. In ganz Frankreich werden Vertreter der Veteranen- und Behindertenverbände, unterstützt von Vertretern der Regierung und der Verfassungsorgane, Kränze an den Kriegsdenkmälern niederlegen.“
Auch am Ende ihres Artikels über die Feier des neuen Nationalfeiertags äußert sich die Behindertenzeitung deutlich:
„Letztendlich kommt es darauf an, dass die Feierlichkeiten zum 11. November frei von jeglichem militärischen Pomp sind. Keine Waffen, keine Paraden, keine Truppenaufmärsche. Wir feiern den Frieden. Nicht den Krieg. Wir wollen, dass die Lebenden ganz auf die Erinnerung an eine Stunde beschränkt bleiben, in der sie den bewundernswerten Gedanken genossen, fortan für den Frieden, für die Zivilgesellschaft leben zu können.“
Aber was ist dann mit den Fahnen, den Signalhörnern, den Marseillaisen? Verrät die Durchführung der Feierlichkeiten zum 11. November nicht diese Absichten? Ist sie nicht ein Zugeständnis an den Militarismus? Ganz und gar nicht, wenn wir diese Zeremonien als eine Reihe artikulierter Zeichen interpretieren. Der Ort der Manifestation ist, wie der Name schon sagt, das Kriegerdenkmal. Es ist kein Altar des Vaterlandes, sondern ein Grabmal. Manche stellen zwar einen triumphierenden Infanteristen dar, doch die meisten sind einfache Stelen ohne glorreiche Konnotationen oder Kokarden. In jedem Fall spielt das Denkmal in der Zeremonie die Rolle eines Grabmals. Das ist in bestimmten katholischen Gemeinden auffällig, wo die Menschen in einer „Prozession“, mit dem Klerus an der Spitze, von der Kirche, in der gerade die Totenmesse gelesen worden war, zum Denkmal zogen, wo der Priester die Absolution erteilte, während der Chor „De Profundis“ singt. Überall wird das Denkmal kollektiv mit Blumen geschmückt – oft legt jedes Schulkind eine Blume oder einen kleinen Strauß dort nieder –, die anschließende Schweigeminute ist eine säkularisierte Form des Gebets, und der Totenaufruf ist dem Nekrologie der katholischen Liturgie entlehnt und entspricht den Richtlinien für Trauerfeiern.
Am 11. November feiern wir vor Denkmälern nicht den Kult des siegreichen Vaterlandes, sondern den der Toten. Das ist so wahr, dass patriotische Lieder selten sind. Hier und da wird die „Marseillaise“ gesungen. Es sollte auch betont werden, dass dieses Lied damals, für diese Generation, nicht von politischen Parteien vereinnahmt wurde: Es war die Nationalhymne, die der Revolutionäre von 1789, die der Republik. Am 11. November feiern wir nicht den Nationalismus angesichts der Fremden, sondern den Bürger, der für die Freiheit starb, wie die Bedeutung der Gespräche und Bewegungen bestätigt. Die Zeremonie wird nicht von Beamte, sondern von den Kämpfern, die sich symbolisch mit ihren Fahnen an der Seite des Denkmals, also an der Seite der Toten, aufstellen. Die Beamten kommen und legen einen Kranz nieder: Sie sind es, die sich bewegen und den Toten Respekt erweisen. Um sich dieser Ehrerbietung anzuschließen, verneigen sich die Fahnen respektvoll als Zeichen der Trauer. Das Große ist nicht das Vaterland, eine abstrakte Einheit, sondern die Bürger, deren Namen in alphabetischer Reihenfolge oder in der chronologischen Reihenfolge ihres Todes, ausnahmsweise jedoch in der militärischen Rangordnung, in das Denkmal eingraviert sind. Wie könnten wir heute diese abschließenden Worte nicht mit unseren Augen betrachten, wenn wir wissen, was danach in den Jahren 39-45 geschah, in Indochina, Algerien und heute mit diesen modernen Kriegen, die die gesamte Menschheit zerstören und prägen:
„Wäre das ganze Geld, das für den Krieg ausgegeben wurde, für den Frieden ausgegeben worden? Für sozialen, industriellen und wirtschaftlichen Fortschritt? Das Schicksal der Menschheit wäre ganz anders. Armut wäre weitgehend aus dem Universum verbannt, und die finanziellen Belastungen, die künftige Generationen belasten, wären nicht mehr abscheulich und erdrückend, sondern im Gegenteil segensreiche Lasten universellen Glücks. Verflucht seien der Krieg und seine Täter!
Wenn wir jemanden, der nicht gekämpft hat, sagen hören: „Krieg ist ein Unglück, dessen Wiederholung um jeden Preis vermieden werden muss“, haben wir das Gefühl, dass derjenige, der diese Bemerkung macht, ihre Bedeutung nicht ganz begreifen kann. Uns scheint, dass der Wunsch, den er äußert, nur platonisch sein kann. Wagen wir es heute zu sagen, dass der Krieg für die Kämpfer von 1914 bis 1918 „ein schrecklicher, verzweifelter Kampf gegen die Erde war, die die Menschen mit Tausenden und Abertausenden unsichtbarer Tentakeln aufsaugt, verschlingt und in einen klebrigen, wankenden Schlamm zieht: die Erde, in der wir mit ein und demselben Spatenstich unsere Unterkunft und unser Grab gruben; die Erde, in der wir lebten, in der wir starben und unvorstellbarem Leid ein Ende setzten; die Erde, der Schlamm, der fast ebenso sehr aus unserem Schweiß, unseren Tränen und unserem Blut wie aus dem Wasser des Himmels gemacht ist.“ Für uns ist Krieg nicht der Schmerz anderer, das Elend anderer; es ist „unser“ Schmerz, „unser“ Elend; für uns ist es die Realität aller Gräueltaten.“
Ich lade Sie ein, die Richtlinien dieser Nachkriegszeit von 1922 für das darauffolgende Handeln mit den Augen von heute zu würdigen:
„Die Zeit ist nicht mehr reif für Notlösungen, für Stückwerk. Wir müssen den Mut haben, groß zu denken und eine neue Ordnung vorzubereiten. Die Wurzel des Bösen liegt in den Köpfen der Menschen. Die wesentliche Reform ist die des Gemeinsinns. Wir müssen: – Dienen, anstatt uns selbst zu dienen. – Unsere Pflichten erfüllen, bevor wir unsere Rechte einfordern. – Moralische und spirituelle Werte über materielle stellen. – Sektierertum in all seinen Formen und woher auch immer bekämpfen. – Die Bedeutung des Familienheims wiederentdecken. - Die Menschenwürde wiederherstellen. - Den Mut haben, die rasche Beseitigung von Missbrauch, Pfründen und Mehrfachbesetzungen zu fordern. - Korruption gnadenlos bekämpfen, wo immer sie auftritt und wie hoch die Täter auch sein mögen. - Die soziale Ordnung auf ihren beiden natürlichen Grundlagen wiederherstellen: Familie und Beruf. - Die Autorität wiederherstellen, ihr ausreichend Stabilität verleihen und sie von der intoleranten Tyrannei von Parteien und Gruppen, von den Begierden und Kräften des Geldes befreien. - Eine strikte Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz gewährleisten. - Überhöhte Steuern und Inflation vermeiden, die Elend und Ruin verursachen. - Die öffentliche Rechnungslegung vereinfachen und unnötigen und kostspieligen bürokratischen Aufwand beseitigen."
Leider könnte diese Rede auch heute noch gehalten werden... Im Rückblick von rund 107 Jahren sind die Ergebnisse beredt, ja, wahrlich: „Verflucht seien der Krieg und seine Täter...“
Christian Morisot
Die Weigerung, den 11. November zum Anlass einer Militärdemonstration zu nehmen, wurde in verschiedenen Reden, insbesondere auf dem Kongress der Französischen Union, mit folgenden Worten deutlich gemacht:
„Die Feierlichkeiten zum 11. November werden keine Militärdemonstrationen beinhalten. In ganz Frankreich werden Vertreter der Veteranen- und Behindertenverbände, unterstützt von Vertretern der Regierung und der Verfassungsorgane, Kränze an den Kriegsdenkmälern niederlegen.“
Auch am Ende ihres Artikels über die Feier des neuen Nationalfeiertags äußert sich die Behindertenzeitung deutlich:
„Letztendlich kommt es darauf an, dass die Feierlichkeiten zum 11. November frei von jeglichem militärischen Pomp sind. Keine Waffen, keine Paraden, keine Truppenaufmärsche. Wir feiern den Frieden. Nicht den Krieg. Wir wollen, dass die Lebenden ganz auf die Erinnerung an eine Stunde beschränkt bleiben, in der sie den bewundernswerten Gedanken genossen, fortan für den Frieden, für die Zivilgesellschaft leben zu können.“
Aber was ist dann mit den Fahnen, den Signalhörnern, den Marseillaisen? Verrät die Durchführung der Feierlichkeiten zum 11. November nicht diese Absichten? Ist sie nicht ein Zugeständnis an den Militarismus? Ganz und gar nicht, wenn wir diese Zeremonien als eine Reihe artikulierter Zeichen interpretieren. Der Ort der Manifestation ist, wie der Name schon sagt, das Kriegerdenkmal. Es ist kein Altar des Vaterlandes, sondern ein Grabmal. Manche stellen zwar einen triumphierenden Infanteristen dar, doch die meisten sind einfache Stelen ohne glorreiche Konnotationen oder Kokarden. In jedem Fall spielt das Denkmal in der Zeremonie die Rolle eines Grabmals. Das ist in bestimmten katholischen Gemeinden auffällig, wo die Menschen in einer „Prozession“, mit dem Klerus an der Spitze, von der Kirche, in der gerade die Totenmesse gelesen worden war, zum Denkmal zogen, wo der Priester die Absolution erteilte, während der Chor „De Profundis“ singt. Überall wird das Denkmal kollektiv mit Blumen geschmückt – oft legt jedes Schulkind eine Blume oder einen kleinen Strauß dort nieder –, die anschließende Schweigeminute ist eine säkularisierte Form des Gebets, und der Totenaufruf ist dem Nekrologie der katholischen Liturgie entlehnt und entspricht den Richtlinien für Trauerfeiern.
Am 11. November feiern wir vor Denkmälern nicht den Kult des siegreichen Vaterlandes, sondern den der Toten. Das ist so wahr, dass patriotische Lieder selten sind. Hier und da wird die „Marseillaise“ gesungen. Es sollte auch betont werden, dass dieses Lied damals, für diese Generation, nicht von politischen Parteien vereinnahmt wurde: Es war die Nationalhymne, die der Revolutionäre von 1789, die der Republik. Am 11. November feiern wir nicht den Nationalismus angesichts der Fremden, sondern den Bürger, der für die Freiheit starb, wie die Bedeutung der Gespräche und Bewegungen bestätigt. Die Zeremonie wird nicht von Beamte, sondern von den Kämpfern, die sich symbolisch mit ihren Fahnen an der Seite des Denkmals, also an der Seite der Toten, aufstellen. Die Beamten kommen und legen einen Kranz nieder: Sie sind es, die sich bewegen und den Toten Respekt erweisen. Um sich dieser Ehrerbietung anzuschließen, verneigen sich die Fahnen respektvoll als Zeichen der Trauer. Das Große ist nicht das Vaterland, eine abstrakte Einheit, sondern die Bürger, deren Namen in alphabetischer Reihenfolge oder in der chronologischen Reihenfolge ihres Todes, ausnahmsweise jedoch in der militärischen Rangordnung, in das Denkmal eingraviert sind. Wie könnten wir heute diese abschließenden Worte nicht mit unseren Augen betrachten, wenn wir wissen, was danach in den Jahren 39-45 geschah, in Indochina, Algerien und heute mit diesen modernen Kriegen, die die gesamte Menschheit zerstören und prägen:
„Wäre das ganze Geld, das für den Krieg ausgegeben wurde, für den Frieden ausgegeben worden? Für sozialen, industriellen und wirtschaftlichen Fortschritt? Das Schicksal der Menschheit wäre ganz anders. Armut wäre weitgehend aus dem Universum verbannt, und die finanziellen Belastungen, die künftige Generationen belasten, wären nicht mehr abscheulich und erdrückend, sondern im Gegenteil segensreiche Lasten universellen Glücks. Verflucht seien der Krieg und seine Täter!
Wenn wir jemanden, der nicht gekämpft hat, sagen hören: „Krieg ist ein Unglück, dessen Wiederholung um jeden Preis vermieden werden muss“, haben wir das Gefühl, dass derjenige, der diese Bemerkung macht, ihre Bedeutung nicht ganz begreifen kann. Uns scheint, dass der Wunsch, den er äußert, nur platonisch sein kann. Wagen wir es heute zu sagen, dass der Krieg für die Kämpfer von 1914 bis 1918 „ein schrecklicher, verzweifelter Kampf gegen die Erde war, die die Menschen mit Tausenden und Abertausenden unsichtbarer Tentakeln aufsaugt, verschlingt und in einen klebrigen, wankenden Schlamm zieht: die Erde, in der wir mit ein und demselben Spatenstich unsere Unterkunft und unser Grab gruben; die Erde, in der wir lebten, in der wir starben und unvorstellbarem Leid ein Ende setzten; die Erde, der Schlamm, der fast ebenso sehr aus unserem Schweiß, unseren Tränen und unserem Blut wie aus dem Wasser des Himmels gemacht ist.“ Für uns ist Krieg nicht der Schmerz anderer, das Elend anderer; es ist „unser“ Schmerz, „unser“ Elend; für uns ist es die Realität aller Gräueltaten.“
Ich lade Sie ein, die Richtlinien dieser Nachkriegszeit von 1922 für das darauffolgende Handeln mit den Augen von heute zu würdigen:
„Die Zeit ist nicht mehr reif für Notlösungen, für Stückwerk. Wir müssen den Mut haben, groß zu denken und eine neue Ordnung vorzubereiten. Die Wurzel des Bösen liegt in den Köpfen der Menschen. Die wesentliche Reform ist die des Gemeinsinns. Wir müssen: – Dienen, anstatt uns selbst zu dienen. – Unsere Pflichten erfüllen, bevor wir unsere Rechte einfordern. – Moralische und spirituelle Werte über materielle stellen. – Sektierertum in all seinen Formen und woher auch immer bekämpfen. – Die Bedeutung des Familienheims wiederentdecken. - Die Menschenwürde wiederherstellen. - Den Mut haben, die rasche Beseitigung von Missbrauch, Pfründen und Mehrfachbesetzungen zu fordern. - Korruption gnadenlos bekämpfen, wo immer sie auftritt und wie hoch die Täter auch sein mögen. - Die soziale Ordnung auf ihren beiden natürlichen Grundlagen wiederherstellen: Familie und Beruf. - Die Autorität wiederherstellen, ihr ausreichend Stabilität verleihen und sie von der intoleranten Tyrannei von Parteien und Gruppen, von den Begierden und Kräften des Geldes befreien. - Eine strikte Gewaltenteilung und die Unabhängigkeit der Justiz gewährleisten. - Überhöhte Steuern und Inflation vermeiden, die Elend und Ruin verursachen. - Die öffentliche Rechnungslegung vereinfachen und unnötigen und kostspieligen bürokratischen Aufwand beseitigen."
Leider könnte diese Rede auch heute noch gehalten werden... Im Rückblick von rund 107 Jahren sind die Ergebnisse beredt, ja, wahrlich: „Verflucht seien der Krieg und seine Täter...“
Christian Morisot
Veröffentlichen Sie Ihren Text
Ehemalige der Legion: Über die Legion und andere Themen
Unterstützer: Über die Legion
Vorname
Familienname
Veröffentlichen Sie hier Ihren Text
Ihre Geschichte zum Upload, max. 5 MB
0 datei(en)